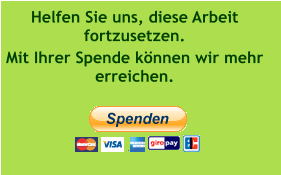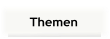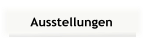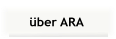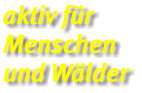
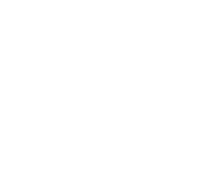
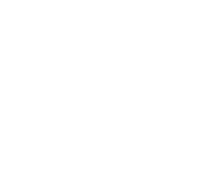

Erfolg vor dem Interamerikanische
Gerichtshof für Menschenrechte
Die ecuadorianische Urwaldgemeinde Sarayaku hat Rechtsgeschichte geschrieben. Ende
April 2012 besuchte der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof zum ersten Mal ein
indigenes Volk in seinem Territorium. Dies war die letzte Etappe in einem neunjährigen
Musterprozess um das "Recht auf vorherige Konsultation" indigener Völker bei
Großprojekten.
Die Kichwa werfen dem Staat Ecuador vor, die Aktivitäten ausländischer Erdölfirmen durch
die Armee abgesichert zu haben. In den letzten 30 Jahren wurden mehreren Ölfirmen
Konzessionen in ihrem Gebiet erteilt, 1996 der argentinischen Firma CGC. 2002 und 2003
drangen Ölarbeiter in Begleitung von Soldaten auf das Gemeindegebiet vor, zerstörten 260
Hektar Urwald und vergruben 1.450 Kilogramm Sprengstoff für seismografische Messungen
im Boden. 2005 kam der Konflikt vor das Menschenrechtsgericht. Doch auch unter dem
linken Präsidenten Rafael Correa argumentiert der Staat wie unter Vorgänger Lúcio
Guitérrez. General Óscar Troya bestritt gar, dass die Armee auf das 137.000 Hektar große
Territorium vorgedrungen sei, und warf den Aktivisten vor, den Dialog zu verweigern.
Erdöl bedroht Lebensgrundlagen
Durch die auch weiterhin geplante Ölförderung sehen die 1.300 Einwohner Sarayakus ihre
Existenzgrundlage bedroht. 1996 hatte die CGC die Förderkonzession für den Block 23
erhalten, der in das 1.300 Quadratkilometer große Gemeindegebiet hineinreicht. Nach dem
Widerstand Sarayakus zog sich die Firma zurück und verklagt Ecuador vor einem
Schiedsgericht der Weltbank. Die Kichwa fordern von der Regierung ebenfalls Entschädigung
sowie die Beseitigung des Sprengstoffs.
Vor Ort war auch Alexis Mera, ein Berater des ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa.
Er erklärte, dass der Staat an einer Wiedergutmachung interessiert sei. Gleichzeitig
betonte er aber auch das Recht des Staates, die Bodenschätze auszubeuten, um mit den
Erträgen Schulen, Gesundheitsstationen und Straßen bauen zu können.
Staatschef Correa wies wenig später in einer Fernsehansprache auf die Verantwortung
seiner Vorgänger im Fall Sarayaku hin. Die "vorherige Konsultation" sei nicht
gleichbedeutend mit einem Vetorecht. Den Indígenas warf der Staatschef vor, den Konflikt
künstlich zu verlängern, um jegliche Ölforderung im Amazonasgebiet zu verhindern. Dabei
setzten sie auch auf die Hilfe ausländischer Umweltgruppen, schimpfte Correa: "Empörend,
dass diese Gringos mit vollem Bauch herkommen, um hier das zu versuchen, was sie in
ihren eigenen Ländern nie geschafft haben."
Dies wurde von Patricia Gualinga, der Sprecherin der Frauen von Sarayaku scharf
zurückgewiesen. Es sei eine Beleidigung für das Volk von Sarayaku, dass man ihm
abspräche, eigene Entscheidungen treffen zu können. Auch nannte sie ein prominentes
Gegenbeispiel: Im Yasuni-Nationalpark soll auf die Förderung von Öl verzichtet werden,
wenn internationale Geldgeber entsprechend hohe Entschädigungszahlungen aufbringen.
Hier werde die Hilfe ausländischer NROs vom Staat als internationale Solidarität deklariert.
Besonders angespannt ist die Debatte vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen
über die Neuvergabe von Erdölkonzessionen für das gesamte südliche Amazonasgebiet
Ecuadors (einschließlich Sarayaku) und dem angekündigten Widerstand fast aller indigenen
Organisationen.